Mannheim, Magdeburg, Aschaffenburg, München und Wien: in den vergangenen Monaten wurde eine erschreckend hohe Anzahl terroristischer Attentate verübt. Dabei zeigt sich immer wieder: Viele dieser Taten werden nicht ohne Vorzeichen begangen – Gewalttäter*innen hinterlassen oft Hinweise auf ihre Absichten. Dieses Phänomen wird als „Leaking“ bezeichnet. Prof. Dr. Rebecca Bondü, Professorin für Entwicklungs-, Pädagogische und Familienpsychologie und Leiterin des M.Sc. Psychologie: Rechtspsychologie, erforscht dieses Thema seit vielen Jahren. Im Interview erläutert sie die Ergebnisse ihrer Forschung und ihre Bedeutung für die Prävention von terroristischen Attentaten:

PHB: Frau Prof. Bondü – was genau versteht man unter dem Begriff Leaking?
Prof. Rebecca Bondü: Unter Leaking versteht man alle Äußerungen oder Verhaltensweisen, mit denen eine Person auf Ideen, Fantasien, positive Bewertung oder Pläne für eine schwere Gewalttat hinweist, die von Außenstehenden zumindest potentiell beobachtet werden können und die es noch erlauben würden, zu intervenieren. Zu Leaking zählen also beispielsweise Äußerungen zu einer Tatplanung im direkten Kontakt oder im Internet, Rechtfertigungen früherer Taten oder beobachtbare Tatvorbereitungen.
PHB: Und wie häufig kommt es vor, dass Täter*innen solche Ankündigungen oder Hinweise hinterlassen?
Rebecca Bondü: Das ist natürlich einerseits abhängig von der einzelnen Person aber auch von der Art der Gewalttat, um die es sich handelt. Im Falle von terroristischen Taten beispielsweise, insbesondere islamistisch motivierten terroristischen Taten, konnte Leaking in fast allen Fällen im Vorfeld der Tat beobachtet werden. Hinzu kamen weitere Warnsignale. Vor Partnerschaftstötungen kam Leaking nicht ganz so regelmäßig vor. In beiden Tatbereichen konnten wir aber bestimmte Merkmale und Inhalte von Leaking und anderen Warnsignalen identifizieren, die zuverlässig auf eine spätere Tatausführung hindeuteten und die genutzt werden können, um das Tatrisiko abzuschätzen. Diese Befunde haben wir in die beiden Risikoanalyseinstrumente LATERAN-IT zu islamistisch motivierten terroristischen Taten und GaTe-RAI zu Partner:innentötungen integriert.
PHB: Gibt es typische Muster und Warnsignale bei Menschen, auf die man achten sollte?
Prof. Rebecca Bondü: Ja, bestimmte Formen, Merkmale und Inhalte von Leaking und anderen Warnsignalen deuten auf ein erhöhtes Tatrisiko hin. Die genauen Merkmalskonstellationen sind dabei auch vom konkreten Deliktbereich abhängig. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass Tatvorbereitungen, Ankündigungen gegenüber Dritten oder auffällige Verhaltensänderungen Aufmerksamkeit verdienen, insbesondere wenn diese gehäuft auftreten. Es ist daher wichtig nachzufragen, ob es womöglich noch mehr davon gibt, wenn man auf Leaking oder andere Warnsignale aufmerksam geworden ist. Denn diese können nicht einzeln und für sich genommen, sondern immer nur in der Gesamtschau betrachtet werden. Ziel ist immer, ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten. Denn einzelne Signale bedeuten nicht automatisch, dass eine Tat geplant ist, und sie können auch auf ganz andere Problemlagen hinweisen.
PHB: Wie kann man reagieren, wenn man solche Anzeichen mitbekommt?
Prof. Rebecca Bondü: Es ist wichtig, solche Beobachtungen nicht einfach zu ignorieren. Gerade wenn man mitbekommt, dass es weitere Warnsignale gibt: wenn es also schon früher ähnliche Aussagen oder Ankündigungen gab. Oder wenn es andere auffällige Verhaltensänderungen gibt, die auf eine Tatbereitschaft hindeuten könnten. Dann sollten die relevanten Informationen an die verantwortlichen Polizeibehörden weitergegeben werden. Diese verfügen einerseits über die Expertise und wenn erforderlich über die rechtlichen Mittel, weitere Informationen einzuholen und ein Tatrisiko zu beurteilen.
PHB: Welche Herausforderungen und Potentiale sehen Sie für die Anwendung des Wissens zu Leakingphänomenen?
Prof. Rebecca Bondü: Das Phänomen Leaking ist leider noch nicht bekannt genug und auch die von der Wissenschaft entwickelten Bewertungskriterien müssen noch weitere Verbreitung finden. Das kann bei der adäquaten Einschätzung eines Falls sehr hilfreich sein. Die von uns erarbeiteten Kriterien und die Instrumente LATERAN-IT und GaTe-RAI fußen auf empirischen Daten und bieten somit objektive Entscheidungshilfen. Sie haben außerdem in den ersten Evaluationen gute Ergebnisse gezeigt. Trotzdem bleibt in der Interpretation dessen, was als Leaking betrachtet werden sollte und was nicht, immer ein Spielraum. In einigen Fällen sind Leaking und andere Warnsignale auch erst in der Rückschau eindeutig als solche erkennbar. Kein Risikoanalyseinstrument weist eine hundertprozentige Treffsicherheit auf.
PHB: Auf welche anderen Bereiche ist die Forschung an Leakingphänomenen übertragbar?
Prof. Rebecca Bondü: Leaking wurde bislang in den Bereichen School Shootings, Terrorismus und Partner:innentötungen untersucht. In allen diesen Deliktbereichen fanden sich zuverlässige Hinweise auf Leaking und seinen Beitrag zur Risikoeinschätzung. Insofern ist davon auszugehen, dass Leaking auch bei allen anderen zielgerichteten Gewalttaten eine Rolle spielen kann.
Zur Person
Prof. Dr. Rebecca Bondü leitet seit 2018 an der PHB den Fachbereich Entwicklungs-, Pädagogische und Familienpsychologie. Sie hat außerdem die Studiengangsleitung für den neuen M.Sc. Psychologie: Rechtspsychologie inne. In ihrer Forschung untersucht sie unter anderem seit vielen Jahren Leakingphänomene als Ansatzpunkte zur Prävention terroristischer oder anderer Gewalttaten. Die Forschungen wurden in Zusammenarbeit mit anderen Universitäten sowie Polizeibehörden durchgeführt.

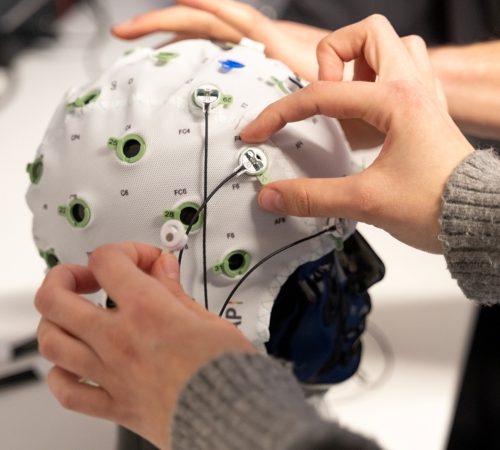
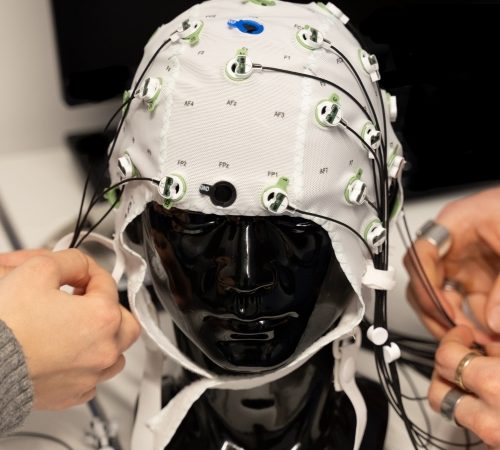
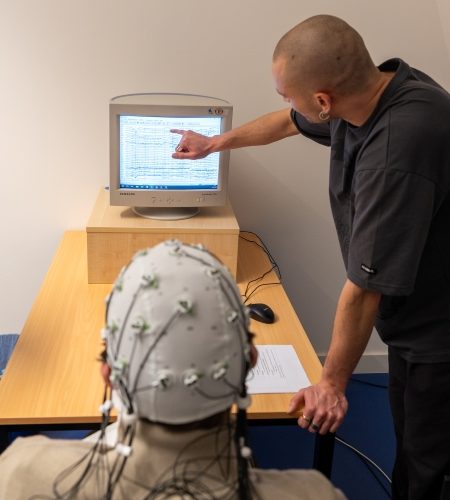









 Der Verein der Freunde und Förderer engagiert sich ideell, inhaltlich und finanziell für die Entwicklung der PHB, ihrer Nachwuchswissenschaftler*innen und -psychotherapeut*innen. Wann immer Studierende der PHB besondere Aufwendungen haben, die ihrer akademisch-beruflichen Weiterentwicklung dienen, z.B. durch die Teilnahme an Kongressen, Tagungen oder Workshops können sie zur finanziellen Unterstützung einen Förderantrag an den Förderverein der PHB stellen.
Der Verein der Freunde und Förderer engagiert sich ideell, inhaltlich und finanziell für die Entwicklung der PHB, ihrer Nachwuchswissenschaftler*innen und -psychotherapeut*innen. Wann immer Studierende der PHB besondere Aufwendungen haben, die ihrer akademisch-beruflichen Weiterentwicklung dienen, z.B. durch die Teilnahme an Kongressen, Tagungen oder Workshops können sie zur finanziellen Unterstützung einen Förderantrag an den Förderverein der PHB stellen.